Probiotika für gesunde Menschen sind ein großer Trend. Und versprochen wird alles von „Darm aufbauen“ bis „Immunsystem stärken“. Doch halten die kleinen Kapseln mit Milliarden von Bakterien wirklich, was sie versprechen?
In diesem Artikel schauen wir uns an, warum das Darmmikrobiom so wichtig ist, was die Wissenschaft zu Probiotika bei gesunden Menschen sagt und warum oft eine ballaststoffreiche Ernährung die bessere Wahl ist.
Probiotika für Gesunde: Bringen sie wirklich was?
Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel ist riesig. Laut Marktforscher Mintel wurde im Jahr 2023 der Umsatz in Deutschland auf 1,78 Milliarden Euro geschätzt. Ein neuer Trend sind Probiotika. Sie werben damit den „Darm aufbauen“, das „Immunsystem stärken“ oder das „Wohlbefinden zu fördern. Und das verfängt.
Darmgesundheit ist das neue Trendthema in der Gesundheitsbubble – vom Influencer bis zur Forschungsarbeit. Das Interesse ist berechtigt: vieles deutet darauf hin, dass Gesundheitsprobleme mit unserem Darmbiom zusammenhängen. Wäre es da nicht schön all unsere Ernährungsprobleme mit einer Pille Bakterien zu lösen?
Warum ist unsere Darmflora so wichtig ist
Die meisten Bakterien und anderen Spezies unseres Darmbioms kommen im Dickdarm vor. Man kann sich das wie ein komplexes Ökosystem aus Bakterien, Pilzen und Phagen vorstellen, ein bisschen wie ein Urwald. Im besten Fall ist dieses System im Gleichgewicht und die verschiedenen Stämme halten sich gegenseitig im Zaum.
Das Darmbiom verdaut Lebensmittel und Nährstoffe, die von unserem Magen und Dünndarm übrig gelassen werden. Wenn der Nahrungsbrei im Dickdarm ankommt, schnappt sich jedes Bakterium die Nahrung, die es verstoffwechseln kann und scheiden dann andere Stoffe dafür aus.
Das können Vitamine sein aber auch kurzkettige Fettsäuren (short chain fatty acids, SCFA). Die SCFA sind wichtige Energielieferanten für unsere Darmzellen. Und diese Stoffe wiederum reagieren mit unserem Körper. Sie regulieren zum Beispiel unser Immunsystem.
Probiotika im Darm kann auch schaden
Wie empfindlich dieses Mikrobiom, also das Ökosystem unseres Dickdarms ist, zeigt ein Beispiel. Die Grenze zwischen Darm und dem Inneren unseres Körpers ist nur eine Zellschicht dick. Wird sie durchbrochen gelangen die Bakterien und Stoffe des Darms unkontrolliert in unseren Körper und richten Schaden an.
Viele Forschungergebnisse und Hypothesen deuten an, dass unser Darmbiom an einigen Volkskrankheiten beteiligt ist wie Adipositas, Diabetes, Depressionen und Autoimmunerkrankungen. Viele Details und genaue Wirkungsweisen sind aber noch unbekannt.
Ein gesundes Mirkobiom und eine Intakte Darmbarriere sind also sehr wichtig für unsere Gesundheit.
Darmgesundheit messen: Diversität als Marker
Woher wissen wir aber, was ein gesundes Darmmikrobiom ist? Die gängigste Methode und am leichtesten verständlichste ist die Diversität. Die Theorie: je mehr verschiedene Bakterien wir haben, desto stabiler ist das Ökosystem und desto gesünder ist es.
Oft sieht man in indigenen Bevölkerungsgruppen, die keine westliche Nahrung essen, höhere Vielfalt in deren Mikrobiomen.
Aber eine hohe Diversität heißt nicht automatisch, dass wir gesund sind. Viele Lebensmittel fördern das Wachstum von Bakterien, die uns schaden. Das ist klassisch zum Beispiel Junk Food.
Es gibt auch keine einheitlichen Analyse-Methoden. Gerade frei verkäufliche Test und Messungen sind nicht standardisiert. Und die Ergebnisse sind schwer interpretierbar. Wir haben Milliarden verschiedene Bakteriestämme in uns, dabie sind gerade eine Handvoll richtig erforscht.
Einzelne Bakterienarten können je nach gesundheitlichem Kontext positiv oder negativ auswirken. Probiotika bei Gesunden verheißen also nicht nur Gutes.
Diversität gleich gesund ist also eine schwierige Aussage. Fakt ist es ist schwierig zu messen und zu sagen wie ein gesundes Darmmikrobiom aussieht.
Ein Präparat für alle wird es nicht geben – und das ist wissenschaftlich klar.
Forschung ist kompliziert: Darum sind Ergebnisse oft unscharf
Die Forschung hat bisher viele Assoziationen gefunden. Das bedeutet sie habe haben herausgefunden Menschen die ein solches Darmbiom haben, sind tendenziell gesund bzw. ungesund. Ob und was die Ursache ist, bleibt aber oft unbekannt.
Mirkobiome sind wie ein Fingerabdruck. Also bei jedem Menschen unterschiedlich und keines gleicht dem anderen. Es ist also bisher schwierig zu verallgemeinern. Und ein Präparat für alle ist heute und auch in Zukunft unrealistisch.
Eine relativ bekannt Studie, das American Gut Projekt, hat zum Beispiel herausgefunden, dass Personen, die regelmäßig 30 oder mehr verschiedene Pflanzen essen, tendenziell gesünder sind und eine höhere Diversität ihres Darmbioms aufwiesen.
30 Pflanzen in der Woche zu essen, ist sicher kein Allheilmittel aber es ist zumindest ein alltagsnaher Ansatz.
Was ist in Probiotika-Kapseln drin – und was bedeutet KBE?
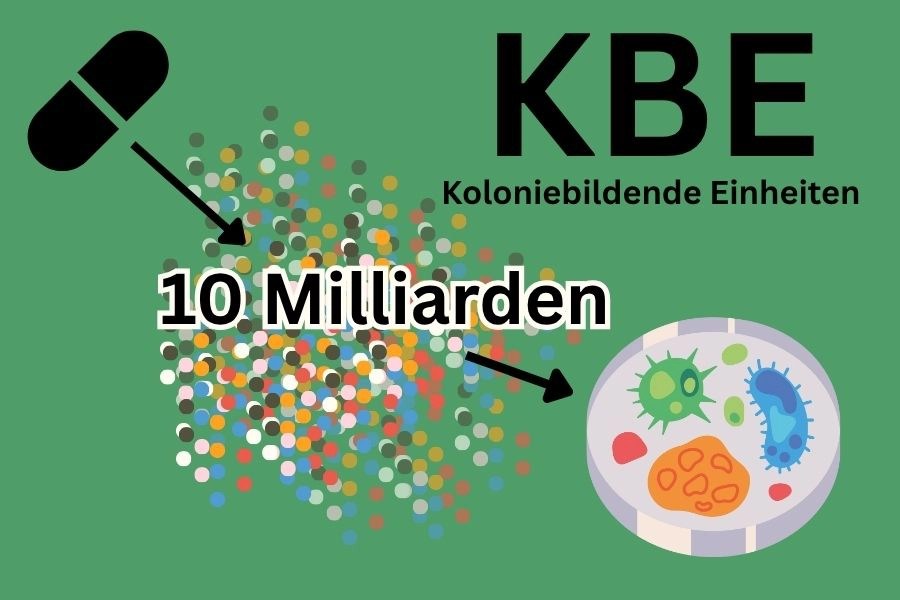
Meistens befinden sich in den Kapseln eine Mischung aus Lactobacillus-, Bifidobacterium- und weiteren Bakterienarten und manchmal Hefen (Saccharomyces boulardii). Das sind Standardstämme, die industriell leicht zu züchten und zu verarbeiten sind aber nicht zwangsläufig die mit der besten Evidenz. Viele Supplements kosten gerade mal 20 Euro.
Das Problem ist: um diese Bakterien Studien zuzuordnen, die Wirknachweise liefern fehlt die Bezeichnung des genauen Stammes. Zum Beispiel L. rhamnosus GG. Selbst wenn es also Studien gibt, wissen wir nicht, ob einer der untersuchten Stämme in der Kapsel sind.
Was ist KBE (koloniebildende Einheit)?
Die KBE-Angabe bedeutet wie viele koloniebildene Einheiten im Produkt sind. Das heißt aus wie vielen Bakterien können neue entstehen. Also quasi wie viele lebendigen Bakterien sind in der Kapsel. Angegeben wird das in Milliarden pro Kapsel. Zum Beispiel 10 Mrd. KBE.
Wichtig: die Menge allein sagt nichts über die Wirksamkeit aus. Am Ende ist der genaue Bakterienstamm und die Umstände der einnehmenden Person entscheidend.
KBE sagt letzten Endes etwas darüber aus, ob die Bakterien aufgrund ihrer Anzahl überhaupt eine Chance habe im Darmbiom zu überleben und einen Einfluss zu haben.
Warum Probiotika bei Gesunden ohne Beschwerden kaum belegt sind
Studien zu gesunden Menschen zeigen bisher kaum Gesundheitsvorteile und die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Die meisten Bakterien siedeln sich nicht dauerhaft im Mikrobiom an und damit endet ein möglicher Effekt auch mit der Einnahme.
Gleichzeitig reagiert jedes Mikrobiom anders auf die Bakterien. Das beudeuten, um mich zu wiederholen: eine Lösung für alle Menschen wird es nicht geben.
Aber es gibt auch nachgewiesene Effekte.
Wo Studien helfen: Probiotika bei Antibiotika-Durchfall
Ein ganz bekanntes Beispiel ist die Einnahme von Saccharomyces boulardii und bestimmte Lactobacillus-Stämmen. Sie verkürzen nach Antibiotikaeinsatz die Dauer und Schwere von Durchfall. Diese Medikamente kann der Arzt verschreiben und für sie gibt es Wirknachweise.
Auch für manche chronische Durchfallerkrankungen (z. B. bei C. difficile-Rezidiven und Reizdarm) gibt es begrenzte Evidenz für ganz spezifische Stämme. Also auch hier wieder keine Lösung über die Menge oder die Masse.
Diese Ergebnisse lassen sich auch nicht auf gesunde Menschen im Alltag übertragen.
Warum Probiotika nach Antibiotika nicht immer helfen
Au man jetzt sagt er das Gegenteil. Hier geht es um den Fall, wenn man keine krasse Diarrö hat. Dazu habe ich bereits einen Artikel geschrieben. Zusammengefasst kann die Probiotika-Einnahme die Erholung des Darmbioms verzögern und zwar um mehrere Monate.
In der Untersuchung schnitten am besten die Proband*innen ab, die eine gesunde und ballaststoffreiche Ernährung hatten.
Andere Risiken von einer blinden Einnahme von Probiotika-Kapseln sind mögliche Infektionen bei Immunschwäche und eine Beeinflussung der mikrobiellen Balance. Das heißt man kann sein Mikrobiom auch nachhaltig schädigen mit solchen Supplementen.
Fazit: Probiotika meist Geldverschwendung – lieber ballaststoffreich & vielfältig

Für gesunde Menschen gibt es keinen klaren Nachweis, dass Probiotika einen Nutzen bringen. Tendenziell können sie sogar schaden. Sie sind also in der Regel Geldverschwendung.
Viel besser und auch nachhaltiger ist es, das eigene Mikrobiom mit der richtigen Nahrung zu unterstützen. Das sind Ballaststoffe, viele unterschiedliche pflanzliche Nahrungsmittel und fermentierte Lebenmittel. Eine schöne Möglichkeit ist mal zu zählen wie viele unterschiedliche Pflanzen man in der Woche ist. Am besten wären über 30. Je mehr desto besser.
Bei fermentierten Lebensmitteln empfehle ich gerne Kimchi: ein scharf eingelegter Kohl aus Korea. Der ist recht leicht selbst gemacht und schmeckt als Beilage zu vielem. Gerne könnt ihr mein Rezept ausprobieren.
Zähl doch mal mit: Wie viele verschiedene Pflanzen esst ihr in einer Woche? Schreibt es mir in die Kommentare.
Quellen
Größe des Supplementmarktes in Deutschland:
https://store.mintel.com/de/reports/deutschland-vitamine-und-nahrungsergaenzungsmittel-markt-report
American Gut Project – 30 Pflanzen pro Woche und Diversität:
https://www.wcrf.org/about-us/news-and-blogs/could-you-eat-30-plant-based-foods-each-week/
Suez et al. (2018) – Probiotika verzögern Mikrobiom-Regeneration nach Antibiotika:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30193113/
Hill et al., 2014 – Definition und Kriterien für Probiotika (FAO/WHO-Update):
https://doi.org/10.1038/nrgastro.2014.66
McFarland, 2010 – Saccharomyces boulardii bei Durchfall (Review):
https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v16/i18/2202.htm
Goldenberg et al., 2015 – Probiotika gegen Antibiotika-assoziierte Diarrhö:
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004827.pub4/full



